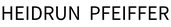Kostbarer Samt und schlichtes Leinen werden zu Trägern einer gemeinsamen Bildfläche. Der edle Glanz des Samts verweist auf
Wertschätzung und Fülle, während das grobe Leinen für Bescheidenheit und Reduktion steht. Doch über diese Gegensätze legt sich die weiche Bewegung der Wüstenformen, die in sanften Schwüngen und
Schattierungen beide Stoffe miteinander verbindet.
Die Wüste, hier als Metapher für Weite, Stille und existenziellen Gegensatz, vereint Extreme: Fülle und Leere, Härte und Schönheit, Vergänglichkeit und Dauer. In
diesem Spannungsfeld verschmelzen Stoff und Bild, Oberfläche und Tiefe, bis die Unterschiede an Bedeutung verlieren und eine stille Einheit sichtbar wird.
So lädt das Werk ein, die Dialektik von Gegensätzen als Möglichkeit der Vereinigung zu begreifen.
Precious velvet and simple linen become carriers of a shared canvas. The noble shine of the velvet signifies
appreciation and abundance, while the rough linen stands for modesty and reduction. Yet, over these contrasts, the soft movement of desert forms stretches, gently intertwining both fabrics with
smooth curves and shading.
The desert, here as a metaphor for vastness, silence, and existential contrast, unites extremes: abundance and emptiness, harshness and beauty, transience and
permanence. In this tension, fabric and image, surface and depth merge, until the differences lose their significance and a quiet unity becomes visible.
Thus, the work invites one to perceive the dialectic of opposites as a possibility for union.

GRENZEN
Heidrun Pfeiffers Werk zeichnet sich durch ein Verständnis von der Grenze als eine nur vorübergehend gültige Markierungslinie aus, die es sich zu verschieben lohnt. Die Annäherung an die Grenze ermöglicht der Künstlerin sich gegen den dabei aufkommenden Widerstand zu stellen und stärker zu positionieren, schöpferische Energie und Farben in einen Fluss zu bringen, welcher sich neue Wege bahnt.
Grenzen werden von kontrastierenden Farbflächen behauptet, streng geometrisch eingehalten oder in organischen Ausläufern erweitert und schließlich wieder aufgehoben. Diese malerischen Grenzüberschreitungen beleben die Leinwand. Mäandernde Linien führen durchs Bild und geben Anlass die gesetzten Anordnungen zu lösen, sie in Bewegung zu versetzen und ihr Zusammenkommen als ein momentanes zu verstehen. Immer wieder leuchtet durch die größeren Areale eine darunterliegende Farbe hindurch und bringt die Schichten des Bildes in Dialog miteinander. Andernorts streift ein einzelner Pinselstrich oder eine schon halb verwischte Spur eines der wabernden Felder, konturlos und in ständiger Bewegtheit verschwimmend. Statt eines statischen Endpunktes stellt das Bild einen Ausgangspunkt für die in ihm begonnenen Entwicklungen dar und wächst darin über sich selbst hinaus.
Dieses Wachstum wird im Motiv der Pflanzen gegenständlich, die sich beispielsweise in der Serie Eingegrenzt wiederfinden. Zwischen und über die Pflanzen schieben sich dort monochrome Farbflächen, gegen die sich jene behaupten müssen. Unaufhörlich vorangehende Lebensprozesse werden kurzzeitig fixiert und offenbaren Konflikte zwischen Werden und Vergehen. Die gestaltlos lauernde Bedrohung in jedem Augenblick der Gegenwart und die Möglichkeit dieser Augenblicke sich tausendfach in die Zukunft zu verzweigen sind simultan existent. Wo die Farbebene in den Bildern von der Triebkraft der Vegetation aufgesprengt wird, tut sich ein fruchtbarer Abgrund auf, aus dem Blätter und Ranken wuchern. So brechen sie aus der vormaligen Enge der dominierenden Hintergrundfarbe aus und eröffnen in ihrem Streben einen neuen Bildraum.
In ihren Holzskulpturen begibt sich die Künstlerin mit der Kettensäge an ihre eigenen physischen Grenzen sowie an jene, die das Material ihr entgegensetzt und fordert diese beharrlich heraus. Sukzessive reduziert sie den gewachsenen Block zu Figuren und Formen, die ebenfalls der Natur entspringen. In der Arbeit Der gemeine Efeu etwa ist das titelgebende Gewächs auf untrennbare Weise mit dem Holz verbunden und geht sogar aus ihm hervor; eine Verschränkung von Werkstoff und Gestalt, die erneut die schier grenzenlose Wachstumskraft des Lebendigen thematisiert.
Alexander Wacker